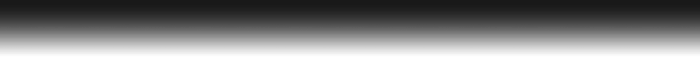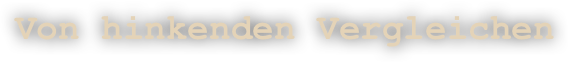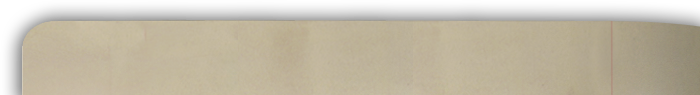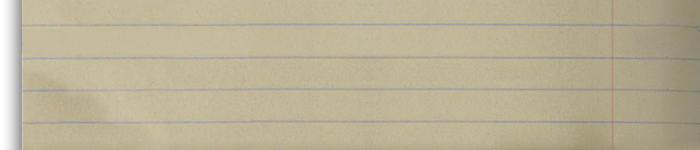Wie immer in der Adventszeit habe ich auch in diesem Jahr eine Art kleine Weihnachtspredigt verfasst. In diesem Jahr spielt sie aber nicht in lauschigen Stuben unter glitzernden Christbäumen, sondern auf hoher See.
Vergleiche haben häufig die unschöne Eigenschaft, gewaltig zu hinken. Dennoch ziehen wir sie gerne heran, um mit ihnen unsere Aussagen zu veranschaulichen und den Empfängern unserer Botschaften griffige Bilder vor Augen zu führen. Dagegen ist auch prinzipiell nichts einzuwenden, solange allen Beteiligten klar ist, dass der Vergleich, so zutreffend er auch erscheinen mag, doch auch seine Schwächen hat und einer Sache nie gänzlich gerecht werden kann. Problematisch wird es, wenn ein Vergleich zu einem fixen Bild wird, das sich in den Köpfen festsetzt und das Handeln bestimmt. In Zeiten der Krise ist es vor allem ein Vergleich, der bis zum Überdruss reproduziert wird, nämlich der vom sinkenden Schiff. Immer wieder kann man ihn von den verschiedensten Seiten hören, und gleich im Anschluss folgt dann ein Rat, wie man sich auf dem sinkenden Schiff zu verhalten habe. Dabei ist doch gar nicht ausgemacht, was genau das Schiff sein soll, das da sinkt. Ein bestimmter Staat? Oder gleich die ganze EU? Der Euro? Die Demokratie? Die Menschlichkeit? Je nachdem, mit wem man spricht, erhält man unterschiedliche Auskunft. Die Strategie jedoch, die man im Falle eines sinkenden Schiffes anzuwenden hat, ist allen klar: sich in Rettungsbooten abseilen. Wenn alles untergeht, dann werden wir in unserem Boot übrig bleiben, die letzten Gerechten, den Stürmen und Fährnissen einer entfesselten See trotzend. So stellen wir uns das ungefähr vor, und wir sind beileibe nicht die Einzigen. Derzeit scheint mir, dass viele Menschen in Europa solchen Phantasien nachhängen: lauter von einander unabhängige Boote, die, natürlich nur mit den Guten, Fleißigen und Aufrechten bestückt, allein übers Meer schippern. Aber wie geht es weiter? Ich versuche mir auszumalen, was passiert, wenn wir erst einmal sicher in unseren Booten hocken. Was geschieht mit denen, die zusammen mit dem großen Schiff untergegangen sind, die sich nicht auf Boote retten konnten? Werden sie nicht rufend und schreiend versuchen, in unsere Boote zu klettern? Dagegen lässt sich leicht vorgehen, nicht? Wir stellen einfach Wachen auf, die die Ertrinkenden von Bord schubsen. Das Boot ist voll, rufen wir ihnen zu.
Was hier so grausam klingt, ist nichts als das konsequente Zu-Ende-Denken des Vergleichs mit dem sinkenden Schiff. Das ist nämlich häufig ein Kardinalfehler beim Heranziehen von Vergleichen: Sie sind kaum wirklich durchdacht und werden nur selten in ihrer vollen Tragweite betrachtet. Ich habe mir daher die Zeit genommen, Recherchen zum wohl berühmtesten Beispiel für ein untergegangenes Schiff anzustellen, nämlich die RMS Titanic, gesunken am 15. April 1912. Mühelos kann man im Lexikon allerlei Wissenswertes dazu erfahren: 1514 Menschen oder 68 Prozent der Passagiere haben diese Katastrophe nicht überlebt. Das lag an mehreren Faktoren. Zum einen gab es insgesamt zu wenige Rettungsboote. Zum anderen aber war das Verhalten der Untergehenden unsolidarisch und egoistisch. Rettungsboote wurden zu Wasser gelassen, ohne voll besetzt zu sein. Von 1178 Rettungsbootplätzen wurden nur 705 besetzt. 473 Plätze blieben leer. Passagiere erster Klasse wurden gegenüber denen zweiter und dritter Klasse deutlich bevorzugt. Am schlimmsten dran waren die männlichen Mitglieder der Besatzung, also Kellner, Köche, Heizer, Maschinisten usw.: von ihnen überlebten nur 22 Prozent. Als die Titanic tatsächlich unterging, trieben viele Menschen im eiskalten Wasser. Die Rettungsboote, die, wie bereits erwähnt, längst nicht alle voll besetzt waren, ruderten aber keineswegs zu den panisch um Hilfe Schreienden hin, um wenigstens jetzt noch ein paar Leben zu retten. Ganz im Gegenteil: Sie fuhren vor den Ertrinkenden davon, in der Angst, die Verzweifelten könnten in zu großer Zahl in die – lassen Sie es mich wiederholen – nicht einmal voll besetzten Boote zu klettern versuchen. Nur ein einziges Rettungsboot ist umgekehrt. Es konnte allerdings nur noch fünf Menschen lebend bergen, von denen zwei im Boot verstarben. Erst, als die Hilferufe verstummt waren, kehrte noch ein weiteres Boot um. Nur noch drei zusätzliche Überlebende wurden gerettet. Das Verhalten der Passagiere der Titanic führt uns sehr deutlich vor Augen, was eines der Hauptprobleme ist, wenn ein Schiff sinkt: Plötzlich ist sich jeder selbst der Nächste. Die anderen Mit-Untergehenden werden keineswegs als rettenswert angesehen. Sollen sie doch absaufen. Hauptsache, ich habe mein Plätzchen im Trockenen. Wobei natürlich der Fairness halber zuzugestehen ist, dass auf der RMS Titanic Offiziere dafür sorgten, dass Frauen und Kinder zuerst gerettet wurden. Dies taten sie zum Teil so gründlich, dass Männer, die im Boot noch Platz gefunden hätten, gar nicht aufgenommen wurden. Auch jene, die ständig im übertragenen Sinne von sinkenden Schiffen sprechen, scheinen sehr klare Vorstellungen davon zu haben, wen sie mit in ihr Rettungsboot nehmen und wen nicht. Und auch dort spielt – wieder im übertragenen Sinne – durchaus die behauptete Erst-, Zweit- und Drittklassigkeit der Passagiere eine gewisse Rolle.
Aber die Geschichte der Titanic ist noch nicht zu Ende. Da saßen sie also in ihren Rettungsbooten, die Überlebenden, umgeben von Leichen, die wie kleine Eisberge an ihnen vorbei trieben. Zwei Stunden lang mussten sie bei bitterster Kälte ausharren, bis sie von der RMS Carpathia aufgenommen wurden und nun erst wirklich gerettet waren. Wir sehen also: Die kleinen Rettungsboote waren nur eine sehr dürftige Zwischenlösung. Nach dem Untergang des einen großen Schiffes mussten die Schiffbrüchigen auf die Aufnahme auf ein anderes großes Schiff hoffen. Der Untergang der Titanic war keineswegs das Ende der großen Schiffe an sich. Offensichtlich hat sich der Individualverkehr per Ruderboot über den Ozean als eher problematisch erwiesen.
Was will uns das Beispiel lehren? Ich bin nicht sicher, ob wirklich irgendwelche Schiffe im Sinken begriffen sind. Trotzdem schreien viele schon nach den Rettungsbooten. Sie legen ein Verhalten an den Tag, das frappant an jenes der Passagiere der Titanic erinnert: unsolidarisch und egoistisch. Mögen die anderen untergehen – sie haben’s nicht besser verdient. Dieses Denken bereitet mir Sorgen. Von allen maritimen Vergleichen mit ihren vielen Hinkebeinen scheint mir nämlich einer der am ehesten zutreffende zu sein, und zwar jener, der da lautet: Wir sitzen alle im selben Boot. In unserem Fall mag das Boot ein sehr stattliches Schiff sein mit vielen Decks und gewaltigen Unterschieden zwischen den verschiedenen Klassen. Aber eine Frage bleibt offen: Sollte unser Schiff wirklich sinken, und sollten wir es tatsächlich in unsere kleinen Notboote schaffen - wer bliebe dann noch übrig, uns zu retten?