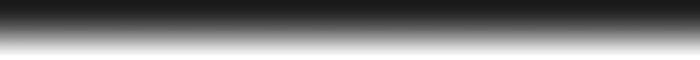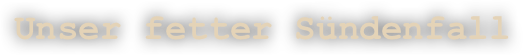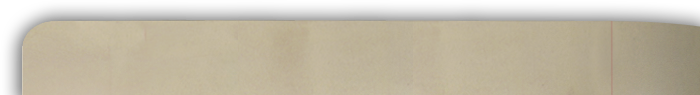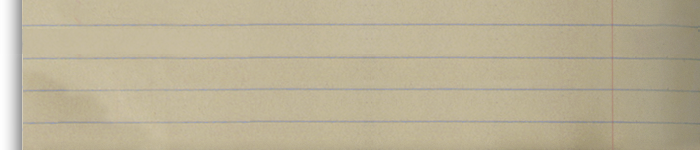„Das Aussehen ist nicht so wichtig, nur die innere Schönheit zählt!“ Wir alle wissen, dass dieser gutgemeinte Spruch zwar politisch korrekt sein mag, in der Realität aber keine Bedeutung hat. Ohne die äußere Schönheit hat unsere innere keine Chance. Und das mit Grund. Das Äußere verrät nämlich viel über das Innere. Oder etwa nicht?
Unsere Gesellschaft wird immer dicker. Übergewichtiger. Fettleibiger. Monströser. Wir schwabbeln einer adipösen Zukunft entgegen, in der keiner mehr einen Schritt zu Fuß tun kann. Wir werden zuckerkrank, herzkrank, leben weniger lang. Und hässlich werden wir außerdem. Die Fettleibigkeit ist die Geisel unseres Jahrhunderts und es ist an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Aufklärungsarbeit ist gefragt. Wir dürfen nicht zulassen, dass es so weitergeht. Weg mit dem Süßkram, her mit der Selleriestange. Verbannen wir das Auto, nehmen wir die öffentlichen Verkehrsmittel. Oder starten wir gleich zu Fuß, das geht schneller. Gesundheit ist das Gebot der Stunde, Gesundheit, Schlankheit und Fitness. Diese drei gehören zusammen. Wer gesund ist, ist schlank und fit und umgekehrt. Außerdem ist der Schlanke zugleich auch der Schöne, der Erfolgreiche, der Disziplinierte. Der Schlanke ist der Gewinner. Der Dicke ist auf der Verliererseite. Jedes Kilo mehr ist ein Punkt weniger auf der Erfolgsskala. Dicke haben ihr Essverhalten nicht im Griff. Damit haben sie auch sich selbst nicht im Griff. Sie sind undiszipliniert und faul. Möglicherweise riechen sie auch komisch. Zuzutrauen wäre es ihnen ja. Dicke sind ja sowieso irgendwie eklig. Schon allein, wie sie sich kleiden. Die Zeltplanen, die sie um sich schlingen, dienen in Afrika ganzen Familien als Unterkunft.
Jetzt aber mal halblang! Das ist ja ungeheuerlich! Was da steht, ist zynisch und menschenverachtend!
Ja, jetzt haben Sie es gemerkt, oder? In diesem Text ist gehörig was faul. Aber lesen Sie sich den ersten Absatz noch einmal in aller Ruhe durch. Ab wann beginnt Ihnen unwohl zu werden? Erst beim abstrusen Vergleich mit den Zeltplanen? Schon vorher, wenn Dicke als unkontrollierte Fresser dargestellt werden? Oder noch früher, wenn Gesundheit, Schlankheit und Fitness zur Einheit erklärt werden? Dabei klingen diese Sätze doch so vertraut, nicht wahr? Das haben wir doch alle schon mal gehört. Die Medien werden nicht müde, uns vor der neuen „Seuche“ zu warnen. Da wird mit Panik-Slogans und Horrorszenarien nicht gespart, und uns ist klar: Alles, nur nicht dick werden!
Aber jetzt wird es schwierig: Ab wann genau ist man denn „dick“? Wo ist die Grenze zwischen den molligen Wohlfühlpölsterchen und dem unheilvollen Todesspeck? Wir haben gelernt, mit unserem Aussehen unzufrieden zu sein. Nase, Haare, Beine, Bauch, irgendetwas bereitet uns ständig Kummer. Aber die Furcht davor, fett zu sein, stellt alles in den Schatten, nimmt bei manchen sogar buchstäblich pathologische Züge an. Jede Frau, aber mittlerweile wohl auch fast jeder Mann, kennt das Unbehagen vor der Waage, kennt die Scham, nicht richtig in die Kleidung zu passen, weil irgendetwas zwickt und drückt, kennt das schlechte Gewissen vor dem Tortenstück, kurz, kennt das Gefühl, einfach nicht schlank genug zu sein. Das ist nämlich der Trick an der Sache: Man ist nie wirklich schlank genug. Dafür sorgt eine ganze Industrie, die davon lebt, uns vor unserem Körper Angst zu machen, um uns dann Produkte zu verkaufen, die uns diese Angst wieder wegnehmen sollen. Maßband und Waage werden zu den Diktatoren eines angeblich gesunden Lebensstils, in dessen Mittelpunkt kalorienreduzierte Nahrungsmittel, dubiose Appetithemmer und obskure Schlankheitspillen stehen. Zugleich sehen wir im Fernsehen superschlanke Bikinischönheiten, die verführerische Kalorienbomben löffeln, stramme Muskelprotze trinken gezuckerte Energiegetränke – ständig flüstert die Werbung: „Gönn dir was“. Essen ist nicht nur Essen. Es geht keineswegs bloß um Nahrungsaufnahme zum Überleben. Essen ist mehr. Die kleine Belohnung nach einer mühevollen Arbeit. Die Entspannung im Freundeskreis. Der Knabberspaß beim Fernsehen. Der Trost nach der Enttäuschung. Essen ist etwas Hochemotionales für uns. Was, wann und wie viel wir essen, hat weniger mit unserem Hungergefühl, als mit unserer Befindlichkeit zu tun. Daher sind Lebensmittel auch nicht wertneutral, sondern mit dem Etikett „gut“ und „böse“ versehen. Wer „böse Lebensmittel“ isst, „sündigt“. Wer sündigt, muss Buße tun. Selbstkasteiung in Form von Gewaltdiäten oder sportlicher Anstrengung soll die „Sünden“ wieder gut machen. Der Schlankheitswahn wird zur Ersatzreligion. So sind wir ständig damit beschäftigt, „Sündenregister“ zu führen. Heute schon so und so viel gegessen – ist da noch ein Nachschlag am Mittagstisch drin? Wir beobachten uns, wir denken über unseren Kalorienverbrauch nach, wir prüfen den Hüftspeck und überlegen, wie wir mehr Zeit für ein bisschen mehr Sport freischaufeln können, um unser schlechtes Gewissen zu besänftigen. In extremen Fällen kann das so weit gehen, dass die Frage Essen oder Nicht-Essen zum Lebensmittelpunkt wird, um den sich alles dreht. Essstörungen haben mittlerweile bei Menschen jeden Geschlechts und jeden Alters, sogar bei Kindern, um sich gegriffen. Verwunderlich ist es nicht. Ein „normales Essverhalten“ gibt es schon längst nicht mehr. Wir werden aufgerieben zwischen „ich müsste“ (mich mehr bewegen, gesünder ernähren...) und „ich sollte nicht“ (naschen, vor dem Fernseher sitzen...). Das Gesunde, das Richtige, das Gute wird somit zur unangenehmen Pflichtübung, das Ungesunde, Falsche, Böse zur verlockenden Versuchung, gegen die wir ankämpfen müssen. Das ist anstrengend und ermüdet. Viele geben irgendwann auf. Es ist einfach zu viel, neben einem fordernden Berufsleben, das immer mehr Menschen vor einem Bildschirm sitzend verbringen, und einem gleichfalls anspruchsvollen Privat- und Familienleben auch noch den täglichen Spießrutenlauf im Kampf gegen das Dickwerden zu bestreiten. Man wird nachlässig. Es gibt im Leben mehr als das ständige Überprüfen des Gewichts. Das Gemüseschnippeln für das bunte Wok-Gericht dauert zu lange, also muss auch mal die Tiefkühlpizza herhalten. Ein Apfel ist vitaminreich, macht aber nicht so satt wie ein Schokoriegel. Und da kommen sie auch schon, die Kilos und die Pölsterchen, schon in kürzester Zeit sind die „Problemzonen“ sichtbar, die „Idealfigur“ ist dahin. Dass diese Idealfigur gar nicht zu halten ist, weil sie eben nur einem Ideal entspricht, das an unserer Realität vorbeigeht, ist nebensächlich. Die Sprache lässt uns im Stich. Wer nicht schlank ist, fällt automatisch in die Kategorie der Dicken. Die Grauzone des „Normalen“ wird als unzulässig ausgeblendet. „Normal“ hat schon gleich den Geruch des latent Übergewichtigen. Sobald sich ein Bäuchlein wölbt oder das Gesäß breiter wird, fällen wir das Urteil: Dieser Mensch gehört also auch zur Legion der Dicken, Faulen, Undisziplinierten. Er lässt sich gehen. Der Dicke ist ein „Sünder“, und als solchen betrachten wir ihn. Wer gesellschaftlich derart abgestempelt wird, verliert aber erst recht die Motivation, im Wettrennen um die richtige Kleidergröße mitzumachen. So entsteht ein Teufelskreis, dem sich kaum jemand entziehen kann. Patentlösungen gegen diese Entwicklung gibt es keine.
Wir können letztlich nur bei uns und unseren eigenen Vorurteilen ansetzen: Trauen wir der molligen Frau überhaupt zu, fleißig und arbeitsam zu sein? Können wir uns vorstellen, dass auch pummelige Menschen schön, gesund und aktiv sein können? Noch wichtiger aber ist die Frage, ob wir uns unseren eigenen Sündenfall verzeihen können: Werde ich noch an mich glauben, wenn mein Äußeres nicht mehr der „Norm“ entspricht? Werde ich den Blick in den Spiegel aushalten, werde ich mich noch mögen? Und wird es mir gelingen, mich auch dann noch für meinen Körper und seine Gesundheit einzusetzen, wenn ich von ihm enttäuscht bin? Wohlbefinden kann nicht durch ständigen Kampf errungen werden. Es stellt sich erst ein, wenn wir den Krieg gegen unseren Körper beenden und mit ihm Frieden schließen. Nur dann können innere und äußere Schönheit um die Wette strahlen.