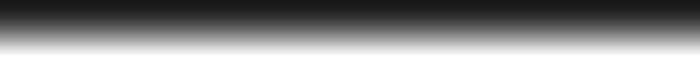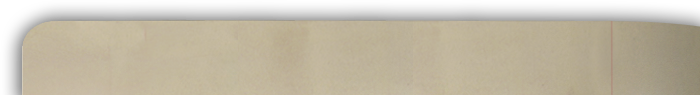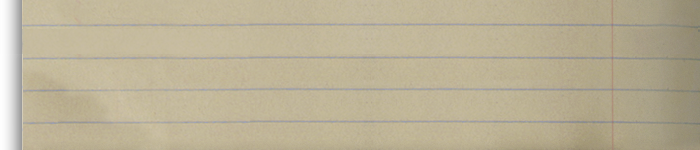Seit einem Jahr schreibe ich monatlich einen Beitrag für die swz. Was mich dabei antreibt, sind häufig Missstände, Schildbürgereien, Allzumenschliches. Ich bin kritisch und manchmal auch bissig und nehme mir kein Blatt vor den Mund. Aber jetzt wird es Zeit, auch das Kritischsein kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Bei keiner Feier fehlen sie, bei keiner Geschäftseröffnung, bei keiner Premiere; sie treiben einfach überall ihr Unwesen: Leute, die ganz offensichtlich nur gekommen sind, um alles schlecht zu finden. Schon bei ihrer Ankunft ist ihr Gesicht verkniffen, und im Laufe des Abends wird es immer verkniffener, bis es einer geballten Faust gleicht. Am Ende der Theateraufführung klatschen sie nicht, schon aus Prinzip. Sie sind ja hier, um kritisch zu sein, da wäre Klatschen ja schon fast eine Art Bankrotterklärung. Beim Buffet schnappen sie sich zwar die Häppchen, aber nur, um sie nachher als „fad“ oder „zu salzig“ oder jedenfalls „einfallslos“ zu bezeichnen. Durch die neuen Geschäftsräume gehen sie mit gestreckten Beinen wie Störche, und wenn ihnen nicht gleich etwas Gehässiges dazu einfällt, dann heben sie einfach nur die Augenbrauen. Ja, jeder von uns kennt solche Leute und war ihrem Spott und ihrer Kritik ausgesetzt. An nichts können sie ein gutes Haar lassen. Dadurch machen sie sich verhasst, aber sie tragen ihre Unbeliebtheit mit der trotzigen Würde der Unverstandenen: Sie selbst sehen sich moralisch zu Kritik verpflichtet. Kritik belebt. Kritik kann sogar dazu anregen, das, was noch nicht gut ist, besser zu machen. Sollten wir daher nicht alle bei der nächsten Gelegenheit mit zusammengezogenen Nasenlöchern herumstehen und alles als dürftig abtun? Wer das Haar in der Suppe nur lange genug sucht, wird es finden. Und mit etwas Übung geht das Herummäkeln immer leichter. Die Zufriedenen aber, die rasch bereit sind, etwas zu bestaunen, die vorbehaltlos „Bravo“ rufen, sind sie nicht auch zugleich die Einfältigen, die Verblendeten, die Korrupten? Ein echter Kritiker lässt sich nicht von Freibier bestechen. Er trinkt das Bier und lästert weiter. Eine noble, eine geradlinige Haltung. Der Kerl zeigt Rückgrat. Wem das nicht passt, der ist ein schlechter Verlierer. Ich gebe es zu, diese Vorstellung ist auf den ersten Blick reizvoll: der Kritiker als wertvolles Mitglied der Gesellschaft, als jemand, der den Finger in die Wunde legt und sich nicht darum schert, wenn die Gesellschaft „Aua“ schreit. So ist das doch. Auch ich selbst gefiele mir in der Rolle derjenigen, die prophetisch Wahrheiten vom Podest herunterposaunt, einer Rolle, die lange nur kirchlichen und allenfalls noch adeligen Führern vorbehalten war. Wer kritisiert, fühlt sich erhaben. Er hat den Durchblick. Er kennt die Lösung und er weiß, wie man dieses Spiel hätte gewinnen können. Schade nur, dass er keine Entscheidungsbefugnis in der Sache hatte. Das Los des Kritikers ist das des ständigen Zu-Spät-Kommens. Das Besserwissen im Nachhinein macht zwar Freude, ist aber wenig originell. Letztlich ist der gesellschaftliche Wert des Stammtischpredigers, des Kritikasters, des Erbsenzählers ein bescheidener, solange er sich auf die bloße Rechthaberei zurückzieht. Daher muss auch ich mich immer wieder von dieser Rolle distanzieren: Kritik ist nicht produktiv. Sie mag zum Nachdenken anregen und oft auch zurecht Missstände anprangern, letztlich trägt sie aber kaum zur Beseitigung der Missstände bei. Schlimmer noch: Wer ständig alles nur schlechtmacht, wird irgendwann nicht mehr ernst genommen. Solche Exemplare kennen Sie auch: Man kann ihnen einfach nichts recht machen – und deswegen versucht man es gar nicht mehr. Sollen sie doch weiter ihr Gift verspritzen, es hat längst seine ätzende Wirkung verloren. So endet der Kritiker als unwillkommener, zugleich aber auch hilfloser Zaungast. Seine Zwischenrufe werden ignoriert.
Dabei könnte es auch anders sein. Wer das Wort „Kritik“ ernst nimmt, weiß, dass damit nicht das Schnüffeln nach Negativem gemeint ist. Wer wahrhaft kritisch sein will, verpflichtet sich dazu, genau hinzusehen. Die Kritik verlangt nach einer präzisen, einer aufmerksamen Beurteilung. Diese kann aber nicht ausgewogen sein, solange das Augenmerk einzig auf dem Negativen ruht. Das Feststellen von guten Entwicklungen, von Fortschritten, von Gelungenem ist genauso Teil einer kritischen Betrachtung. Dann, und nur dann, hat Kritik die Chance, konstruktiv zu wirken. Dasselbe gilt übrigens für die unterschätzte Kunst der Selbstkritik. Sich zu hinterfragen, ist nur fruchtbar, wenn man die Fähigkeit besitzt, seine Schwächen ebenso einzuschätzen wie seine Stärken und weder das eine noch das andere auszublenden. Die entscheidende Frage ist aber, welche Schlüsse man aus der kritischen Betrachtung zieht. Solange es bei Lippenbekenntnissen bleibt, geht die Kritik ins Leere. Veränderung wird nur durch die Tat herbeigeführt. Hier liegt die Grenze des Schreibtischtäters, und doch ist Vorsicht geboten. Das Wort kann anregen, aufpeitschen, hetzen, es kann verblenden, in die Irre führen, Hass säen. Wer mit Worten ficht, trägt Verantwortung. Das Wort, das böse zumal, ist mächtig. Darum braucht jeder wahrhaft kritische Schreiber vor allem eines, damit seine Worte einerseits auf fruchtbaren Boden fallen und andererseits kein Unheil anrichten können: wahrhaft kritische Leser. Auch meinen Texten wünsche ich viele davon.