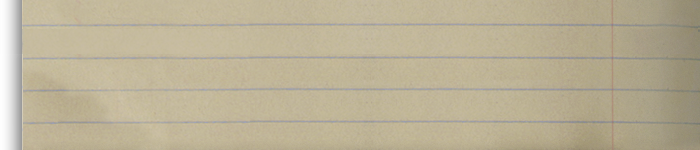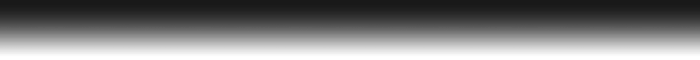

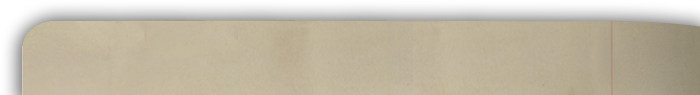

Freitag, 8. April 2011
„Vor dem Gesetz sind alle gleich“ – ein löblicher Grundsatz, der auch im Alltag gelten sollte, oder? „Ja, klar“, rufen Sie. Aber Hand aufs Herz: Ein ganz kleines bisschen Ungleichheit finden Sie doch in Ordnung. Vor allem zu Ihren Gunsten. Nicht wahr?
Mit der Gleichheit ist es so eine Sache. Natürlich will niemand benachteiligt werden und pocht darauf, dieselben Chancen zu bekommen wie alle anderen. Aber angenommen, jemand wird ein wenig bevorzugt? Erhält wertvolle Schützenhilfe bei der Suche nach einem Job, erfährt als erstes vom Traumhaus zum Traumpreis... ? Wer träte da schon so zurück und riefe aus: „Halt, hier bekomme ich Vorteile, die andere nicht haben! Das ist nicht fair!“ Über Ungleichbehandlung regt man sich erst auf, wenn sie einem schadet. Ich jedenfalls habe noch nie von einer Mutter gehört, die zum Lehrer pilgert, weil ihr Sprössling zu hohe Noten bekommen hat. Im Grunde finden wir Besserbehandlung durchaus gerechtfertigt – wenn sie uns selbst betrifft. Wir sind ja auch besonders fleißig oder besonders nett. Dass Besserbehandlung fast immer gleichzeitig auch die Schlechterbehandlung eines anderen mit einschließt, erscheint uns dabei höchstens bedauerlich, wird aber ansonsten nur mit einem Schulterzucken quittiert. Der andere wird es sich schon in irgendeiner Form verdient haben, schlechter behandelt zu werden – oder zumindest hat er nichts dafür getan, ebenfalls Privilegien zu erhalten. Überhaupt das „Verdienen“: Wir sind schnell bereit zu glauben, dass jemand, der sich in einer gehobenen Position befindet, sich diese auch rechtschaffen erarbeitet hat. Und unsere messerscharfe Logik geht sogar noch weiter: Jemand, der auf dem Chefsessel sitzt, finanziell gut dasteht und auf großem Fuß lebt, der soll gar nicht behandelt werden wie jedermann. Dem rollen wir auch mental einen roten Teppich aus. Mein Gott, der achtzigjährige Millionär, der sich mit der knackigen Zwanzigjährigen vergnügt, will eben auch noch mal Spaß im Leben. Der fünfzigjährige Arbeitslose, der sich an eine Studentin heranmacht, ist hingegen ein ekliger Perverser. Gleiches Recht für alle? Pustekuchen! Wir haben eine sehr genaue Vorstellung von Gerechtigkeit und fordern in feurigen Sonntagsreden Chancengleichheit, Weltfrieden und Freibier für alle. Unsere eigenen Widersprüche kehren wir dabei geflissentlich unter den Teppich. Beispiel gefällig? Neulich entdeckte ich auf einer Homepage geharnischte Invektiven gegen China. Ein unmögliches Land, das man nie und nimmer bereisen dürfe, die Leute dort seien seelenlose Kreaturen ohne einen Funken Menschlichkeit im finsteren Herzen. Was war der Grund der ungebremsten Empörung? Wogegen schlug der Hass so meterhohe Wellen? Nein, es wurde nicht die prekäre Lage der Menschenrechte angeprangert, es ging auch nicht um die Tücken eines Regimes, das die eigene Bevölkerung unterdrückt. Es ging darum, dass die schurkischen Chinesen Hunde essen. Und die netten Tierchen werden vorher massenhaft geschlachtet! Und ihre entpelzten Körper hängen kopfüber an Stangen zum Verkauf! Und ihre abgetrennten Köpfe werden auf einen Haufen geworfen! Nur Unmenschen können einem Tier so etwas Schreckliches antun. Ich kann mir die engagierten Tierschützer bildlich vorstellen, wie sie mit Schaum vor dem Mund gegen die Verderbtheit des Chinesen an sich geifern und sich dabei im Übereifer beinahe am Schweineschnitzel verschlucken, das sie sich soeben schmecken lassen. Solche Episoden machen mich nachdenklich. Sind Hunde wertvoller als Schweine? Katzen erhabener als Kühe? Pferde edler als Esel? Ist es nicht Anmaßung, hier Normen aufstellen zu wollen, wonach etwa Wellensittiche nicht, Hühner hingegen schon verspeist werden dürfen? Und dennoch geschieht genau dies: wir unterscheiden sehr genau, wer gleich ist und wer „gleicher“. Und die Maße der Gerechtigkeit kennen noch sehr viel mehr Differenzierungen. Sind Tunesier besser als Marokkaner? Syrische Babys süßer als sudanesische? Wiegt das Leid der Somalier schwerer als jenes der Kongolesen? Täglich und meist fast unmerklich treffen wir Entscheidungen, die, so absurd sie klingen mögen, nach solchen Kriterien gefällt werden. Wem schenken wir unser Mitgefühl? An wen überweisen wir eine Spende? Gegen wen führen wir Krieg? Wen halten wir für die Guten, wen für die Bösen?
Wir brauchen eine Welt der Ungleichen. Sie macht uns das Leben übersichtlich und verständlich und sie gewährt uns den Luxus der kleinen und großen Privilegien, der kleinen und großen Schurkereien, die auf dem Rücken anderer ausgetragen werden. Wir spüren das Missverhältnis, aber wir haben Erklärungen dafür. Je nach Neigung bemühen wir Gott, den freien Markt, das Schicksal oder sonstige höhere Mächte, die „von Zauberhand“ die universelle Ungleichheit verursachten. Dabei heißt es doch, eine gerechte Welt wäre möglich. Eine Welt ohne Hunger, ohne Versklavung, ohne Ausbeutung und ohne Existenznot. Es müsste nur jeder bereit sein, seine Sonderrechte ein wenig zurückzuschrauben und auch anderen einen Teil am Kuchen zuzugestehen. Dieser Ansatz ist durchaus idealistisch. Für realistisch jedoch halte ich ihn nicht. Denn auch in meiner Wohnung liegt der Hund frisch gekämmt im Körbchen und das Schwein gut gewürzt auf dem Teller. Mahlzeit.
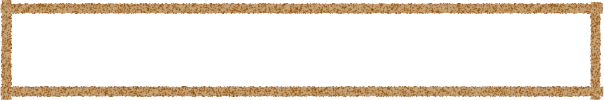
Gleiches Recht für alle?
oder: Die vielen Maße der Gerechtigkeit
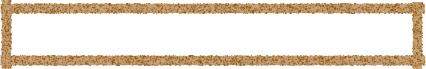
April-Beitrag für die swz 2011