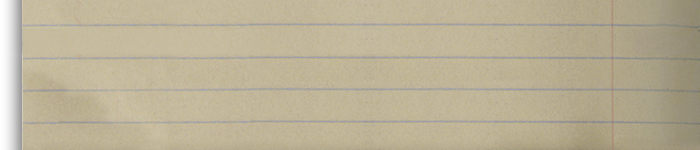Immer häufiger kommt es vor, dass ich mir nach einem langen Tag denke: Und jetzt einfach alles von mir werfen! Den Zimmerservice anrufen! Eine meterlange Bestellung aufgeben! Eine einstündige Massage für die müden Glieder vormerken! Mich verwöhnen lassen! Bei mir zu Hause gibt es aber leider keinen Zimmerservice. Die Bestellung muss ich schon selbst erledigen. Massiert werde ich höchstens vom Duschstrahl, der auf mich herunterprasselt. Bis ich alles getan habe, ist es zum Verwöhnen und Verwöhntwerden zu spät. Ab ins Bett, morgen geht’s von vorne los. Manchmal ist mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen: Ich brauche Urlaub. Wellnessurlaub. Den kann ich mir aber nicht leisten, und daher tu ich das, was ich immer in solchen Situationen mache: Ich denke darüber nach. Ist billiger. Was ist das eigentlich für ein Leben, in dem man Wellnessurlaube nötig hat? Wellness heißt ja im Grunde nichts anderes als „Wohlbefinden“. Wie kommt es, dass ich das Gefühl habe, das Wohlbefinden auf den Urlaub verschieben zu müssen? Sollte ich nicht schon im Alltag, bei den kleinen und großen Aufgaben des Berufs- und Privatlebens, ein Wohlgefühl, eine gewisse Zufriedenheit und ab und zu sogar Freude empfinden? Wie kommt es, dass ich den Eindruck habe, dass ich das alles auf „irgendwann“ verlegen muss? Und wie kommt es, dass ich das Gefühl nicht loswerde, das alles gibt es nur gegen Geld? Wohlbefinden sollte doch kostenlos zu haben sein. Beim entspannten Spaziergang. Beim gemeinsamen Mittagessen. Beim gemütlichen Fernsehabend. Und Wohlbefinden sollte sich nicht nur auf die Freizeit oder den Urlaub reduzieren. Der Glücksmoment bei der Arbeit – es muss ihn doch geben! Und ja, ich erlebe Glücksmomente in meiner Arbeit. Derzeit aber sind sie von einem stechenden Schmerz begleitet: Das alles wirst du nicht mehr lange haben, sagt der stechende Schmerz. Mit Ende des Schuljahres stehe ich – wie so oft – mit leeren Händen da. Und obwohl ich bis dahin noch ein paar Wochen „Schonfrist“ habe, spüre ich die Angst, die an mir nagt. Mit dieser Angst werde ich jedoch allein gelassen. Wer kümmert sich schon um die Befindlichkeiten einer Supplentin? Ich bin austauschbar. Das kränkt. Von klein auf hatte man mir doch eintrichtert, ich sei etwas ganz Besonderes, ein wunderbares Individuum. Ich bin am Ende dieser Lüge angekommen. Ich habe nichts zu bieten, was nicht tausende andere auch bieten. Mein Wert ist immer nur ein vorläufiger. Mit Ende des Arbeitsverhältnisses tauche ich wieder in die anonyme Masse der Arbeitssuchenden. Wir werden immer mehr. Und wir sind immer verzweifelter. Was wir gelernt haben, was wir können, erweist sich als Massenware. Das Besondere, das Herausragende? Ist nicht gefragt und besitzt keinen Geldwert – und damit auch keinen anderen. In allen Ebenen erfahre ich mich als überflüssig. Wirklich gebraucht werde ich nicht. Ich habe keine Wahl und muss nehmen, was ich kriegen kann. Der Arbeitgeber zeigt mir dabei keine Wertschätzung, im Gegenteil, er erwartet meine Dankbarkeit, dass er mich einem anderen vorgezogen und mir die wunderbare Gelegenheit gegeben hat, für ihn zu arbeiten. Viel Platz für Glücksmomente und Zufriedenheit bleibt da nicht. Zum Glück ist Hausarbeit bekanntlich erfüllender – hier kann man sich satte zehn Minuten lang wertvoll fühlen und sich dem Wahn hingeben, man könne noch etwas voranbringen in der Welt. Doch auch diese Illusion zerplatzt spätestens, wenn der Hund sein Wasser auf den frisch gewischten Boden schlabbert. Frustration macht sich breit. Berufs- und Privatleben erweisen sich als mühselige, undankbare und kränkende Tretmühlen, aus denen es kein Entrinnen gibt. Was bleibt, ist der armselige Traum vom Wellnessurlaub irgendwann. Dort aber dann bitte das volle Programm: Alles will ich haben, was ich sonst nicht kriegen kann. Aufmerksamkeit. Freundlichkeit. Das Gefühl, etwas ganz Besonderes, Einmaliges, Niedagewesenes zu sein. Ja, es ist so: Wertschätzung kann man kaufen. Sie ist dann zwar nicht echt, aber sie fühlt sich immer noch echter an als die Wertschätzung im Berufsleben – dort ist sie meist allenfalls ein Lippenbekenntnis, diffus hingestreut bei Weihnachtsreden und Betriebsausflügen. Dann schon lieber die Kellnerin, die mich bei meiner Bestellung anstrahlt, als hätte ich ihr einen Gefallen getan, dann schon lieber der Masseur, der für mich und nur für mich allein da ist. Bezahlte Dienstbarkeiten, freilich. Aber sie liefern das so dringend benötigte Wohlgefühl. Doch womöglich dreht sich die Spirale weiter. Womöglich ist auch die Kellnerin frustriert und träumt abends von der Wellnessoase, womöglich will auch der Masseur einfach nur noch raus aus dem Trott. Dabei könnte Arbeit auch ein Wert für sich sein und nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Doch dafür müssten die Rahmenbedingungen stimmen. Für viele stimmen sie nicht. Für viele ist Arbeit nur das notwendige Übel, mit dem man sein Überleben finanziert, und im Fall der stetig zahlenmäßig zunehmenden „working poor“ trifft nicht einmal das mehr zu. Denke ich an die Massen von Menschen, die vor sich hin schuften, ohne dabei jemals das Gefühl haben, etwas Sinnvolles, etwas Wertvolles und Gutes zu tun, wird mir schwindlig. Mein eigenes Unbehagen, meine eigene Angst erscheinen mir dann geradezu lächerlich. Sklavenarbeit – längst ist sie in unserer Gegenwart keine Ausnahme mehr, längst hat sie auch unsere Breitengrade erreicht. Dann spüre ich die Sozialrevolutionärin in mir, die aufschreien will. Ich habe meinen Forderungskatalog beisammen. Mein erster Punkt: Wellness für alle! Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Wohlbefinden sollte ein Menschenrecht sein. Respekt und Achtung zu erfahren, darf nicht zur Ausnahme werden, die sich nur Betuchte leisten können. Gleich morgen gehe ich mit meinem Transparent auf die Straße, marschiere durch die Einkaufsmeilen. Aber was dann? Wenn Lehrer streiken, freuen sich alle. Die Schüler, weil die Stunden entfallen. Der Arbeitgeber, weil er Geld spart. Und die Eltern haben es ja immer schon gewusst, dass Lehrer faule Säcke sind. Mein Protestmarsch wird zur Farce. Keiner vermisst mich. Und all die anderen schuften weiter in ihren Knochenjobs. Brot mag nicht alles sein, aber ohne Brot lebt es sich noch ein bisschen schlechter. Wo schon der bloße Arbeitsplatz Glückssache ist, wird der Kampf um Wertschätzung zum Luxus. Ein Trumpf aber bleibt mir noch: Wer sich in seiner Arbeit nicht wohl fühlt, leistet weniger, fühlt sich dem Arbeitsplatz nicht verbunden, brennt schneller aus. Auch der Arbeitgeber kann sich nicht damit begnügen, einfach nur Gehaltsschecks auszustellen. Schon jetzt gibt es Arbeitsplätze mit einer sehr hohen Wechselquote. Und ich gebe zu: Auch ich, die es mir kaum leisten kann, bin wählerisch. Nach schlechten Erfahrungen weiß ich, wo ich nie wieder eine Stelle antreten würde und welcher Vorgesetzter ein besonders „undankbares“ Exemplar ist. Es mag sein, dass viele Arbeitnehmer bei der Jobsuche kaum eine Wahl haben. Tatsache ist aber auch, dass Arbeitgeber, denen es nicht gelingt, ein gutes Arbeitsklima herzustellen und denen „wertschätzende Personalführung“ ein Fremdwort ist, irgendwann auch nicht mehr viel Auswahl haben. Wenigstens in diesem Fall könnte es dann sein, dass man das bekommt, was man verdient.
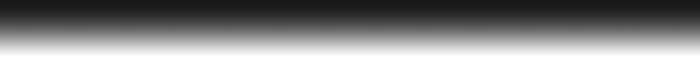
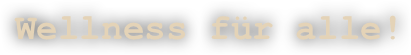
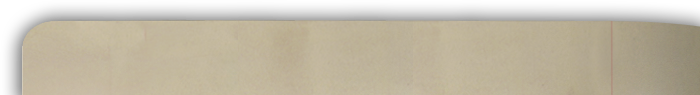
Eine Portion Wellness bitte!
Mai-Beitrag für die swz 2011
Über die Wertschätzung im Berufsalltag